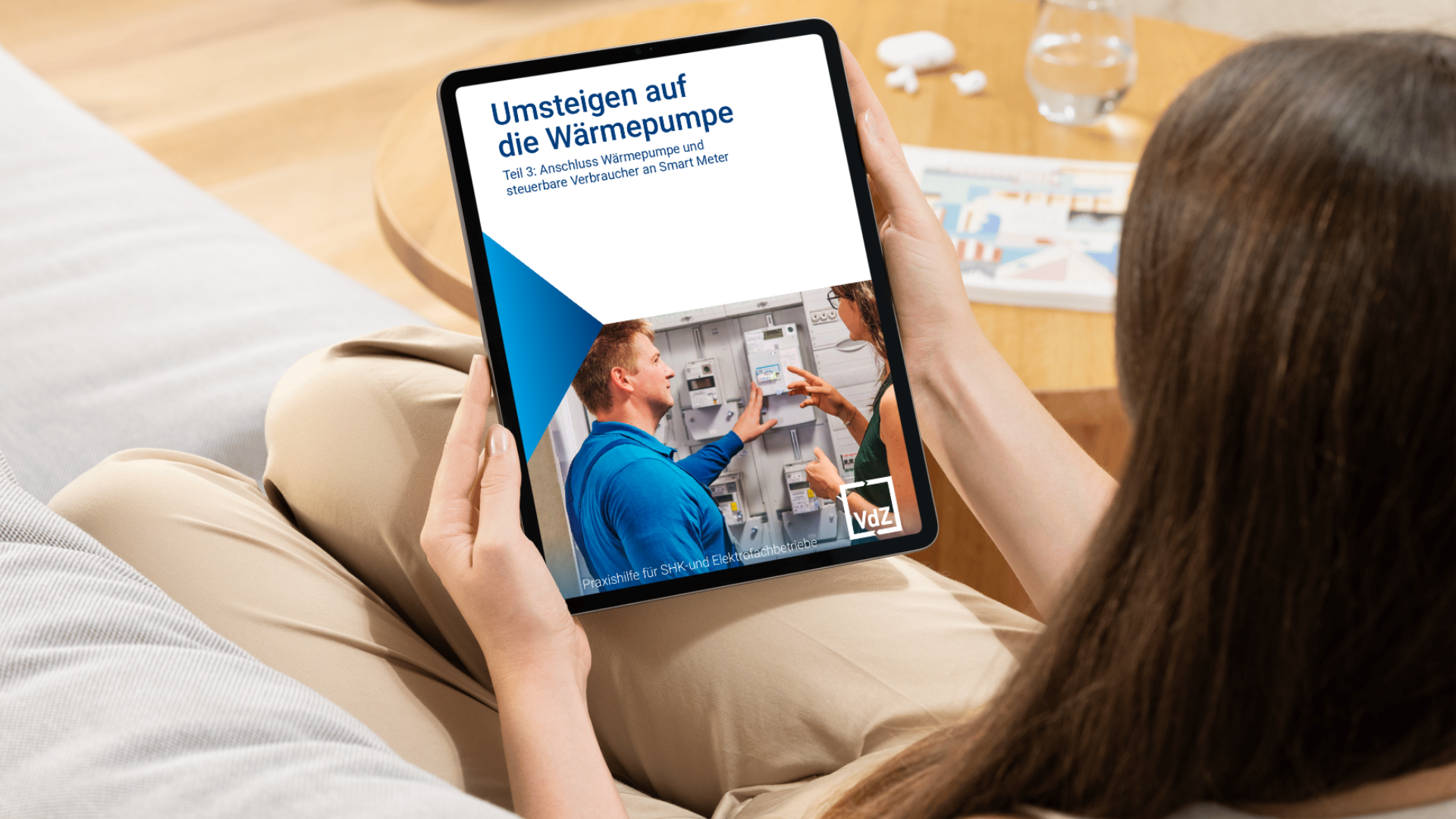Wärmepumpen, Wallboxen und Batteriespeicher sind beliebt. Allerdings belastet der steigende Strombedarf das Stromnetz. Seit 2024 müssen diese Geräte steuerbar sein, um Engpässe zu vermeiden. Doch wie funktioniert das, und welche Optionen gibt es?
Am 1. Januar 2024 ist die Neuregelung zur Integration von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen und steuerbaren Netzanschlüssen nach § 14a Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) in Kraft getreten. Diese sieht vor, dass Netzanschlüsse für Verbrauchseinrichtungen vereinfacht und beschleunigt werden. Im Gegenzug dazu müssen diese Anlagen eine temporäre Begrenzung ihrer Leistung bei hoher Netzauslastung zulassen, also steuerbar gemacht werden. Mit der Neuregelung soll eine Überlastung der Stromnetze verhindert werden, ohne dass Netzbetreiber neue Anschlüsse ablehnen oder verzögern können. Zudem können Sie z. B. von reduzierten Netzentgelten profitieren.
Welche Geräte sind betroffen, welche nicht?
Die neue Regelung nach §14a EnWG betrifft sogenannte steuerbare Verbrauchseinrichtungen (SteuVE) mit einer Leistung von 4,2 kW oder mehr. Betroffen sind u. a.:
- Wärmepumpen (inkl. Zusatz- oder Notheizungen wie Heizstäbe)
- Private Wallboxen für Elektroautos
- Klimaanlagen zur Raumkühlung
- Stromspeicher (außer Nachtspeicherheizungen)
Diese Geräte müssen so gesteuert werden können, dass ihr Stromverbrauch bei einer Netzüberlastung vorübergehend reduziert wird.
Nicht betroffen sind im privaten Wohnbereich kleine Geräte unter 4,2 kW maximale Leistung (einschließlich Heizstäbe).
Was gilt für bestehende Anlagen?
Die Neuregelungen gelten seit dem 1.1.2024. Für zu diesem Zeitpunkt bereits bestehende Anlagen mit vereinbarter Steuerung gilt allerdings eine Übergangsregelung bis 2029. Wurde keine Steuerung für eine bereits bestehende Anlage vereinbart, gilt für diese ein dauerhafter Bestandsschutz.
Bestehende steuerbare Verbrauchseinrichtung (SteuVE) bleiben selbst dann von den neuen Regelungen ausgenommen, falls eine SteuVE neu installiert wird. Im Falle einer SteuVE-Neuinstallation muss jedoch eine bereits vorhandene oder neu installierte erneuerbare Energien Erzeugungsanlage, zum Beispiel eine Photovoltaikanlage, ebenfalls steuerbar gemacht werden.
Ist ein freiwilliger Wechsel zur Neuregelung möglich?
Ja. Wer bereits eine ältere steuerbare Verbrauchseinrichtung besitzt, kann freiwillig in die neue Regelung wechseln. Dies kann sinnvoll sein, wenn man von neuen Preismodellen profitieren möchte.
Wichtig: Wer einmal in die neue Regelung wechselt, kann nicht mehr zurück in den bisherigen Bestandsschutz.
Was bedeutet das für Hauseigentümer?
Wenn Sie eine neue Wärmepumpe, Wallbox oder einen Batteriespeicher installieren, dann:
- Muss das Gerät steuerbar sein, damit der Netzbetreiber es im Notfall regeln kann.
- Darf der Netzbetreiber die Stromaufnahme der Geräte begrenzen, falls eine Netzüberlastung droht.
- Dürfen Netzbetreiber den Anschluss dieser Geräte nicht mehr verweigern oder verzögern, auch wenn das Stromnetz in Ihrer Region stark beansprucht ist.
Welche Möglichkeiten zur Steuerung gibt es?
Als Betreiber eines steuerbaren Geräts müssen Sie sich für eine der beiden folgenden Steuerungsarten entscheiden:
1. Direktansteuerung:
- Jedes Gerät wird einzeln vom Netzbetreiber gesteuert.
- Im Notfall kann der Netzbetreiber den maximalen Strombezug pro Gerät auf mindestens 4,2 kW begrenzen, kann bei Wärmepumpen aber auch höher liegen.
- Bei großen Wärmepumpen und Klimaanlagen mit einer Netzanschlussleistung über 11 kW Leistung muss immer mindestens 40 Prozent der Leistung verfügbar sein. Arbeiten mehrere Geräte in einer Kaskade zusammen, wird diese Konfiguration als eine Anlage gewertet.
2. Steuerung über ein Energiemanagementsystem (EMS):
- Alle steuerbaren Geräte werden miteinander vernetzt und als Gesamtsystem betrachtet.
- Der Netzbetreiber gibt nur eine Obergrenze für den Gesamtstromverbrauch vor, nicht für einzelne Geräte.
- Das EMS verteilt (entsprechend den Nutzervorgaben) den verfügbaren Strom intelligent auf die Geräte. So kann beispielsweise mehr Strom zur Wärmepumpe fließen, wenn die Wallbox gerade nicht genutzt wird.
Wie könnte die EMS-Steuerung beispielhaft aussehen?
Angenommen, Sie haben eine Wärmepumpe, eine Wallbox für Ihr Elektroauto und eine PV-Anlage. Der Netzbetreiber setzt eine Obergrenze für den Gesamtstrombezug auf 8 kW. Ihre PV-Anlage produziert jedoch 3 kW zusätzlichen Strom. Dadurch stehen Ihnen insgesamt 11 kW für Wärmepumpe und Wallbox zur Verfügung.
Das EMS sorgt automatisch dafür, dass die Geräte innerhalb dieser Grenze optimal mit Strom versorgt werden. Falls das Auto fast vollgeladen ist, erhält es nur 5 kW, während die Wärmepumpe, die gerade Warmwasser bereitet, 6 kW bekommt.
Fazit: Auf diese Weise spüren die Hausbewohner kaum Einschränkungen und den zur Verfügung stehenden Strom bestmöglich und optimiert nutzen.
Tipp: Weiterführende und vertiefende Informationen bietet die aktuelle Broschüre „Umsteigen auf die Wärmepumpe Teil 3: Anschluss Wärmepumpe und steuerbare Verbraucher an Smart Meter“.
Foto: Canva